Wann gibt es Schadensersatz bei misslungener Implantat-OP?
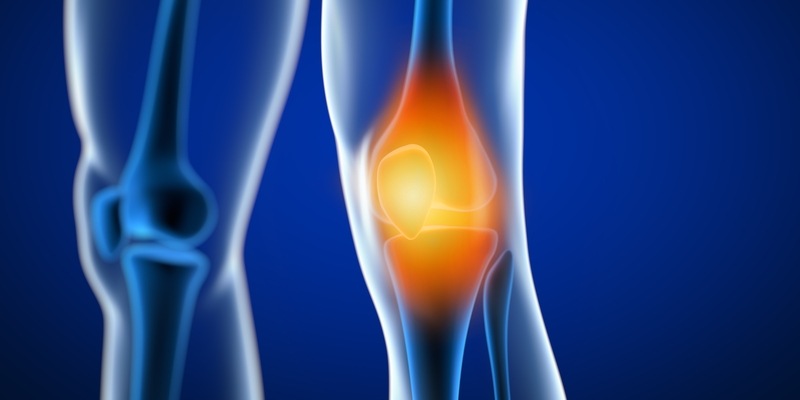 Illustration eines schmerzenden Kniegelenkes © freepik - mko
Illustration eines schmerzenden Kniegelenkes © freepik - mko
Ob Hüftgelenk-, Kniegelenk- oder Brustimplantat-Operation - nicht jede Implantation verläuft erfolgreich. Kommt es zu Komplikationen oder später zu gesundheitlichen Problemen, stellt sich die Frage, ob der Patient Anspruch auf Schadensersatz hat. Wann liegt ein Behandlungsfehler bei einer Implantat-OP vor? Wer muss diesen beweisen? Welche Ansprüche haben Patienten nach einer misslungenen Implantat-OP? Und wie sollten Patienten, die den Verdacht haben, Opfer eines Behandlungsfehlers geworden zu sein, jetzt vorgehen?
- Wann haftet der Arzt für Behandlungsfehler bei einer Implantat-OP?
- Wer muss den Behandlungsfehler bei einer Implantat-OP beweisen?
- In welchen Fällen erhalten Patienten nach einer misslungenen Implantat-OP Schmerzensgeld und Schadensersatz?
- Welche weiteren Ansprüche haben Patienten bei einem fehlerhaften Implantat?
- Haben Patienten Anspruch auf Entfernung eines fehlerhaften Implantats?
- Wie sollten Patienten bei einem Verdacht auf eine fehlerhafte Implantat-OP vorgehen?
- Implantateregister und EUDAMED- Hier können sich Patienten informieren!
Wann haftet der Arzt für Behandlungsfehler bei einer Implantat-OP?
Ein Behandlungsfehler ist gegeben, wenn der behandelnde Arzt bei der Implantat-OP nicht nach den allgemein anerkannten medizinischen Standards gehandelt hat.
Mangelende Aufklärung vor der Implantat-OP
Eine ausführliche Beratung vom Arzt ist vor dem Einsatz eines Implantats zwingend notwendig. Dazu gehört auch, dass der Arzt dem Patienten den Produktnamen des Implantats mitteilt. Der Patient kann so nach Erfahrungen anderer Patienten mit dem Implantat im Internet recherchieren und eventuelle Bedenken erneut mit seinem Arzt besprechen.
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt/Main (Az. 8 U 76/15) reicht die Aufklärungspflicht des Arztes gegenüber seiner Patientin soweit, dass er sie vor einer Brustimplantation zwar über alle Risiken beim Einsetzen des Implantats aufklären muss, er ist aber nicht verpflichtet die Patientin über Risiken bei einer späteren Explantation zu informieren.
Hygienemängel bei der Implantat-OP
Werden bei der Implantat-OP Hygienestandards nicht eingehalten und kommt es infolgedessen zu einer Infektion beim Patienten, kann dies ein schuldhaftes Versäumnis des Arztes sein, für das er haften muss.
Fehlende Nachsorge nach der Implantat-OP
Der Arzt ist verpflichtet, den Heilungsverlauf nach einer Implantat-OP zu kontrollieren. Unterlässt er dies oder übersieht er Komplikationen, kann dies eine Haftung begründen.
Wer muss den Behandlungsfehler bei einer Implantat-OP beweisen?
Grundsätzlich trägt der Patient die Beweislast für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers und eines daraus resultierenden Schadens. Allerdings gibt es gesetzliche Beweiserleichterungen. Liegt ein besonders schwerwiegender Fehler vor, kehrt sich die Beweislast um. Dann muss der Arzt beweisen, dass sein Fehler nicht für den Schaden ursächlich war.
Auch fehlende oder unvollständige Behandlungsdokumentationen können zu einer Beweislastumkehr zugunsten des Patienten führen.
In welchen Fällen erhalten Patienten nach einer misslungenen Implantat-OP Schmerzensgeld und Schadensersatz?
Ein fehlerhaftes Implantat ist für den betroffenen Patienten mit Schmerzen und Eingriffen in seine Gesundheit verbunden. Aus diesem Grund steht ihm dann ein Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz gegenüber dem behandelnden Arzt oder auch dem Hersteller des fehlerhaften Produkts zu. Dazu gehören auch die Kosten für Nachbehandlungen oder Korrekturmaßnahmen.
Hüftprothesen
Das Landgericht (LG) Freiburg (Az. 1 O 460/11, 1 O 223/12, 1 O 266/12) einen international agierenden Hersteller von Hüftprothesen zu Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz verurteilt, weil er für Produktfehler bei seinen auf den Markt gebrachten Hüftprothesen einstehen muss. Die Hüftprothesen führen laut eines Gutachtens zu Metallabrieb, der bei den Patienten gesundheitliche Beeinträchtigungen herbeiführt. Zudem weisen sie insgesamt ein zu hohes Versagensrisiko auf. Zwischen 17.500 und 25.000 Euro Schmerzensgeld erhielten die klagenden Prothesenträger vom Gericht zu gesprochen.
Eine Patientin, der eine Großkopf-Hüfttotalendoprothese im Jahre 2005 implantiert wurde und die Metall aus dem Konusadapter abgab, erhielt vom Prothesen-Hersteller Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 Euro. Dies entschied das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe (Az. 14 U 171/1) und stellt klar, dass eine implantierte Hüftprothese im Sinne der Produkthaftung fehlerhaft ist, wenn ein Metalabrieb in solchen Mengen stattfindet, dass dies gesundheitsgefährlich sein kann.
Nach einem Urteil des Saarländischen Oberlandesgericht (Aktenzeichen 1 U 90/13) erhält eine Patientin keinen Schadensersatz für ein implantiertes schadhaftes Hüftgelenk, wenn das Implantat zum Zeitpunkt der Implantierung dem Facharztanspruch entsprach und gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund eines höhten Kobalt- und Chromabriebs nicht bekannt waren.
Knieprothesen
Aufgrund einer fehlerhaft implantierten Knieprothese sprach das LG Münster (Az.108 O 80/17) einer Patientin 50.000 Euro Schmerzensgeld zu. Die Schlittenprothese war bei der Operation schief in den Oberschenkelknochen eingesetzt worden, weshalb mehrere Folge-Operationen notwendig waren und seither die Funktionsfähigkeit des Knies erheblich beeinträchtigt ist.
Weil eine Knieprothese fehlerhaft im Knie positioniert wurde, erhält eine Patientin 20.000 Euro Schadensersatz, entschied das LG Hamburg (Az. 323 O 62/13).
Empfiehlt ein Arzt nicht eine bakteriell infizierte Knieprothese ausbauen zu lassen, begeht er einen groben ärztlichen Behandlungsfehler, so das OLG München (Az. 1 U 884/13).
Brustprothesen
Rechtsstreitigkeiten um minderwertige Brustimplantate des inzwischen insolventen französischen Hersteller Poly Implant Prothèse (PIP) beschäftigt in Frankreich seit Jahren die Gerichte – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Nachdem viele betroffene Frauen vor Gericht leer ausgegangen sind, hat im Februar 2022 das französische Handelsgericht Toulon den TÜV Rheinland zu einem Schadensersatz in Höhe von rund 8,2 Millionen Euro verurteilt. Geklagt hatten rund 1600 betroffene Frauen, die nun zunächst jeweils rund 5.150 Euro Schadensersatz erhalten. Laut Gericht hat der TÜV Rheinland notwendige Kontrollen über die Herkunft des verwendeten Materials unterlassen. Der TÜV Rheinland will gegen das Urteil in Berufung gehen. Eine Reihe von Klagen im Rahmen des Brustimplantate-Skandals sind noch vor Gericht anhängig.
Den deutschen Patientinnen, die vom Skandal um Billig-Silikonbrustimplantate aus Frankreich betroffen sind, wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) (Az. VII ZR 36/14) kein Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu gesprochen. Nach der Auffassung des Gerichts kommt eine Haftung des Zertifizierers nur in Betracht, wenn ihm bekannt war, dass die Brustimplantate nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen und daher unangekündigte Kontrollen des Herstellers hätten durchgeführt werden müssen. Solche Anhaltspunkte habe es aber für den deutschen Zertifizierer nicht gegeben. Die Haftung der französischen Versicherung entfalle, weil diese ihr Haftung vertraglich wirksam auf Schadensfälle in Frankreich begrenzt habe.
Diese territoriale Haftungsbegrenzung der französischen Versicherungsgesellschaft ist rechtens, entschied der Europäische Gerichtshof (Az. C-581/18). Das allgemeine Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit komme bei dem Vertrag zwischen dem Hersteller von Medizinprodukten und der Versicherung nicht zum Tragen, da dieser Sachverhalt nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts falle. Die vom Brustimplantate-Skandal betroffene deutsche Patientin bekommt demnach keinen Schadensersatz.
Welche weiteren Ansprüche haben Patienten bei einem fehlerhaften Implantat?
Falls der Patient aufgrund der fehlerhaften Behandlung arbeitsunfähig wird, kann ein Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls bestehen. Sollte der Patient aufgrund der Komplikationen seinen Haushalt nicht mehr selbstständig führen kann, besteht ein Anspruch auf Ersatz der dadurch entstehenden Kosten.
Haben Patienten Anspruch auf Entfernung eines fehlerhaften Implantats?
Hat ein Patient den Verdacht, dass bei ihm ein fehlerhaftes Implantat eingesetzt wurde, sollte er seinen behandelnden Arzt aufsuchen und sich umgehend untersuchen lassen. Bestätigt sich die Mangelhaftigkeit des Implantats, hat der Patient einen Anspruch auf Entfernung und Austausch. Die Kosten für diese Operation trägt in der Regel die Krankenkasse. Zu Beweiszwecken sollte sich der Patient das fehlerhafte Implantat nach der Operation aushändigen lassen.
Werden bei einem Implantat Mängel festgestellt, die zu einem Rückruf vom Markt führen, erhalten betroffene Patienten, bei denen das Implantat eingesetzt wurde, nicht zwangsläufig zu einem Anspruch auf Entfernung, wenn das Implantat bei ihnen einwandfrei funktioniert. Anders zu beurteilen sind Fälle, bei denen sich die Fehlerhaftigkeit des Implantats droht zu verwirklichen – etwa bei Prothesen, die sich im Körper langsam zersetzen. Hier hat der Patient ebenfalls das Recht auf einen Austausch des Implantats.
Wie sollten Patienten bei einem Verdacht auf eine fehlerhafte Implantat-OP vorgehen?
Patienten, die den Verdacht haben, Opfer einer misslungenen Implantat-OP geworden zu sein, sollten folgendes tun:
• Arztbericht und Behandlungsunterlagen anfordern
• Zweite ärztliche Meinung einholen
• Anwalt einschalten, um die Erfolgsaussichten einer Klage oder eines Vergleichs zu prüfen
• Gutachten erstellen lassen, etwa durch die Schlichtungsstelle der Ärztekammer oder einen unabhängigen Sachverständigen
• Ansprüche fristgerecht geltend machen, das heißt drei Jahre ab Kenntnis des Fehlers.
Implantateregister und EUDAMED- Hier können sich Patienten informieren!
Ärzte und Patienten können sich im Vorfeld einer Implantate-Operation an Hand des seit dem 1.1.2020 eingeführten bundesweiten Implantateregister im Hinblick auf Haltbarkeit und Qualität von Implantaten informieren. Der Regelbetrieb mit verpflichtender Meldung von implantatbezogenen Informationen mit Brustimplantaten ist am 1. Juli 2024 gestartet. Der Regelbetrieb für die Erfassung von Informationen zu Knie- und Hüftgelenkimplantaten wurde am 1. Januar 2025 aufgenommen.
Für mehr Transparenz bei Prothesen sorgt auch die EU-Medizinprodukteverordnung, nach der seit dem 1.1.2020 jedes Medizinprodukt/Implantat eine individuelle Produktnummer erhalten muss. Diese wird in einem Implantatpass für den Patienten dokumentiert, so dass Verfolgbarkeit und Rückrufaktionen erleichtert werden.
Seit dem 26.5.2021 gelten neue EU-Vorschriften für Medizinprodukte, die unter anderem strengere Kontrollen von Hochrisiko-Produkten, wie Implantaten, vorschreiben. Auch klinische Bewertungen und Prüfungen werden strenger kontrolliert. Patienten können sich über ihr Medizinprodukt in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) informieren.
erstmals veröffentlicht am 23.01.2020, letzte Aktualisierung am 12.03.2025
Lesen Sie hier weitere Fachartikel im Themenbereich Gesundheit & Arzthaftung
Hier finden Sie bundesweit Rechtsanwälte für Arztrecht



